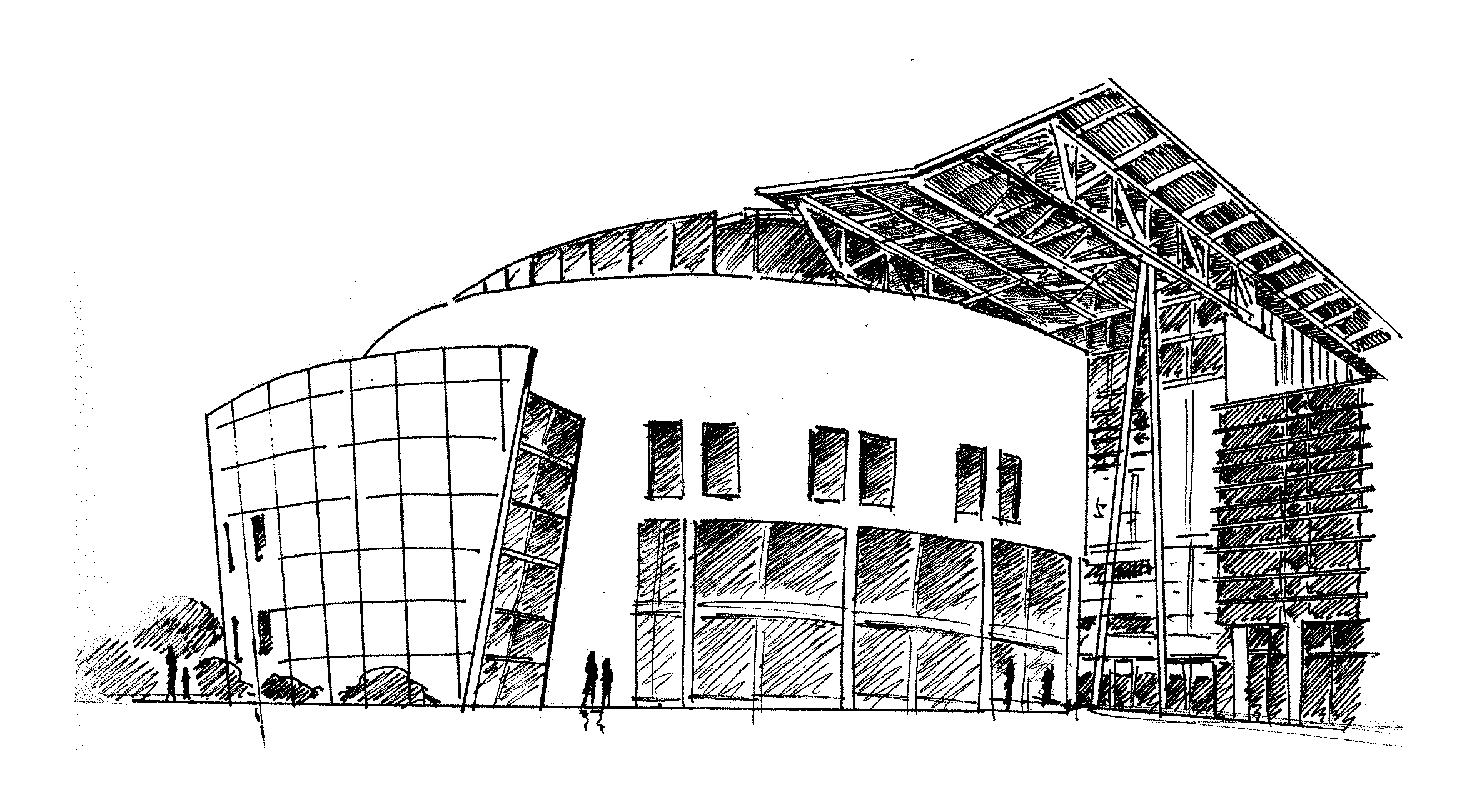Die Abschlussveranstaltung des bayerischen Forschungsnetzwerks bayresq.net am 20. November 2025 im IZB Martinsried markierte einen Höhepunkt in der Bayerischen AMR-Forschung. Während weltweit Millionen Menschen an Infektionen sterben, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken, präsentierten sechs Verbundprojekte ihre wissenschaftlichen Durchbrüche aus sechs Jahren intensiver Forschung
Die Bilanz ist beeindruckend:
Das vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geförderte Netzwerk hat die Forschungslandschaft nachhaltig verändert: 91 wissenschaftliche Publikationen, 7 Patentanmeldungen, 8 Open-Source-Softwarelösungen, 20 abgeschlossene Promotionen, 3 Berufungen und 20 Auszeichnungen für wissenschaftliche Exzellenz. Mehr als 85 Forschende aus ganz Bayern haben in den Projekten DynamicKit, Helicopredict, IRIS, Metabodefense, Rbiotics und StressRegNet neue Wege im Kampf gegen multiresistente Erreger beschritten.

Was die Wissenschaft bewegt: Die Panel-Diskussionen
Nach Keynotes von Prof. Dr. Lothar Wieler, ehemaliger Präsident des Robert Koch-Instituts und heute am Hasso-Plattner-Institut tätig, zur globalen Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen und Prof. Dr. Gitta Kutyniok von der LMU München zu den Auswirkungen von KI auf die Forschung lieferten zwei hochkarätig besetzte Panels substanzielle Impulse für die Zukunft der AMR-Forschung.



Panel I: Digitale Vernetzung als Gamechanger
Unter Moderation von Prof. Dr. Gitta Kutyniok diskutierten Prof. Dr. Rolf Apweiler, Deputy Director General des EMBL-EBI, Prof. Dr. Frauke Kreuter von der LMU München und University of Maryland, Prof. Dr. Zlatko Trajanoski, Direktor des Instituts für Bioinformatik der Medizinischen Universität Innsbruck, und Prof. Dr. Lothar Wieler über die Zukunft von Data Access, Data Sharing und KI in der Forschung.
Prof. Wieler forderte einen grundlegenden Wandel: Es brauche eine Mindset-Änderung. Sein Wunsch sei es, dass die Politik mehr Vertrauen in ihre Bürger und Forscher entwickle.
Prof. Dr. Apweiler plädierte für eine europäische Datensouveränität (insbesondere https://europepmc.org) und einen ausgewogenen Umgang mit Datenschutz: Man lebe zwar im Zeitalter der Privacy, aber Bürger hätten nicht nur ein Recht auf Datenschutz, sondern auch auf die Vorteile, die Datennutzung ermögliche. Zu oft werde reflexartig gewarnt, etwas sei gefährlich, anstatt ebenso die Chancen zu erkennen. Man müsse Datenschutz und gesellschaftliche Vorteile sorgfältig abwägen, denn zu restriktiver Datenschutz stehe oft Fortschritten im Weg. Risikobereitschaft öffne Chancen.



Prof. Dr. Kreuter appellierte an ein konstruktives Miteinander: Vernetzen und miteinander zusammenarbeiten müsse die Devise sein, wobei die Expertin für Soziologie und Statistik das Netzwerk bayresq.net als Vorbild lobte. Ihr Appell an die Politik sei klar: Mehr Mut und Zuversicht zeigen, mehr Vertrauen signalisieren. Politik sollte Verantwortung als Bündelung von Kompetenzen verstehen, nicht als Kontrollinstrument.
Prof. Dr. Trajanoski betonte die Bedeutung der richtigen Fragestellungen, eine Anspielung auf Douglas Adams‘ „Per Anhalter durch die Galaxis“: KI werde immer eine Antwort liefern („42“ auf die Frage nach „dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“), es gilt die richtigen und präzisen Fragen zu stellen. Wichtig sei es, mehr Wert auf sinnvolle KI-Anwendungen in der Forschung zu legen, statt KI für triviale Zwecke einzusetzen („Slop“). Seine Botschaft richtete sich besonders an junge Forschende, die Zukunft der Wissenschaft aktiv zu gestalten, sowie an die Politik, diese Motivation zu fördern und zu ermöglichen.

Panel II: Die Translationslücke schließen
Dr. Rosi Hermann moderierte die Diskussion besonders spannend darüber, wie Translation in zunächst nicht-profitablen Bereichen gelingen kann. Mit ihr diskutierten Prof. Dr. Mark Brönstrup vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Prof. Dr. Peter Hammann, ehemals Sanofi, Dr. Holger Reithinger, Executive Director von CARB-X, und Dr. Robert Macsics, Head of R&D bei GARDP.
Prof. Hammann erinnerte aus Sicht der „Big Pharma“ an kreative Finanzierungsmodelle: Der Staat könnte das Entwicklungsrisiko übernehmen, ähnlich wie beim BAföG. Bei kommerziellem Erfolg würde die Investition zurückgezahlt, bei Scheitern nicht, oder nur Teilweise. Solche Mechanismen könnten die Entwicklung dringend benötigter Antibiotika, aber auch anderer Translationsbereiche fördern, indem Sie die Hürde zum Einstieg in die Startup Welt für qualifizierte Forscher und Entwickler senken.



Prof. Dr. Brönstrup unterstrich die Bedeutung stabiler Grundlagenforschung: Ja, Push-Förderung fehle, aber ohne solide wissenschaftliche Basis führe der Push ins Nichts. Grundlagenforschung sei die Voraussetzung für jeden translationalen Erfolg.


Dr. Hermann brachte die zentrale Herausforderung auf den Punkt: Förderlogik verlange mittelfristige Verwertung. Das sei schwer vereinbar mit wirklich neuen, risikoreichen Innovationen, die längere Entwicklungszeiträume benötigten.
Die Panelisten forderten gemeinsam eine Neuausrichtung der Forschungsförderung: Investitionen in Innovation müssten getätigt und Prioritäten richtig gesetzt werden, nicht nur dem aktuellen Trend gefolgt. Das Prinzip „heute hü, morgen hott“ sei kritisch. Die Corona-Forschung sei ein mahnendes Beispiel: Vor 2019 habe sie niemand fördern wollen, danach sei sie plötzlich hochaktuell gewesen, und Grundlagen aus vorheriger Forschung waren nun maximal wertvoll und hilfreich. Es brauche Forschung auch fernab der Top-Priorities.
Beide Panels unterstreichen, dass erfolgreiche Forschung (gegen multiresistente Erreger) nicht nur auf technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt beruht, sondern auch politischen Willen, eine moderne digitale Infrastruktur und verlässliches Funding benötigt. Das Netzwerk bayresq.net setzt genau hier an – und zeigt: Der Freistaat Bayern bleibt Vorreiter in Spitzenforschung und -technologie.
bayresq.net: Die wissenschaftlichen Durchbrüche:
DynamicKit entwickelte erstmals eine vollständige Pipeline zur Analyse intakter Proteine von Mycobacterium tuberculosis unter Antibiotikastress. Mit MALDI-TOF, HPLC-MS und einer Open-Source-Software können nun Proteinveränderungen in Echtzeit verfolgt werden. Dies ermöglicht personalisierte Therapien gegen multiresistente Tuberkulose. Dies ermöglicht personalisierte Therapien gegen multiresistente Tuberkulose. Vereinfacht gesagt: Die Forschenden können nun in Echtzeit beobachten, wie Tuberkulose-Bakterien auf Medikamente reagieren, und so für jeden Patienten die beste Behandlung finden.
Helicopredict schuf mit über 500 charakterisierten klinischen Isolaten die weltweit größte Datenbank für Helicobacter pylori. Die entwickelten KI-Modelle sagen Resistenzen gegen Clarithromycin, Levofloxacin und Metronidazol präzise vorher. Eine webbasierte Plattform integriert klinische, genomische und mikrobiologische Daten für die klinische Anwendung. Mit anderen Worten: Künstliche Intelligenz kann mittlerweile vorhersagen, welche Antibiotika bei welchem Patienten gegen den Magenkeim wirken werden.
IRIS identifizierte CD86 auf dendritischen DC2-Zellen als essentiellen Checkpoint für die Reaktivierung von Gedächtnis-T-Zell-Antworten gegen Staphylococcus epidermidis. Überraschend war der Befund, dass selbst kommensale Hautbakterien über einen Interferon-gamma zu Stickstoffmonoxid-Signalweg systematische Immunsuppression auslösen können. Dies hat weitreichende Implikationen für Impfstoffentwicklung und Tumorimmunologie. Kurz gesagt: Die Forschenden haben Wege gefunden, das körpereigene Immunsystem gezielt gegen resistente Hautkeime zu aktivieren, und entdeckten dabei, dass selbst harmlose Hautbakterien die Immunabwehr bremsen können.



Metabodefense entdeckte zwei zentrale metabolische Achsen: Den Cholin-Stoffwechsel und den Neurotransmitter-Metabolismus als therapeutische Angriffspunkte. Die pharmakologische Blockierung eines Neurotransmitter-Aufnahmesystems verbesserte die Abwehrleistung gegen Salmonellen signifikant. Die entwickelte MI4-Signatur ermöglicht erstmals eine präzise Unterscheidung zwischen infizierten und nicht-infizierten Zellen, auch bei verschiedenen Erregertypen. Das bedeutet: Der Stoffwechsel von Immunzellen lässt sich so verändern, dass sie Bakterien besser bekämpfen, und ein neu entwickeltes Frühwarnsystem kann infizierte von gesunden Zellen unterscheiden.
Rbiotics etablierte eine experimentelle Pipeline für die Entwicklung von Antisense-Oligomeren als hochspezifische RNA-basierte Antibiotika. Mit dem frei zugänglichen MASON-Webserver können Forschende weltweit passende ASO-Sequenzen designen. Die Technologie ermöglicht gezielte Interventionen gegen pathogene Bakterien, ohne das schützende Mikrobiom zu schädigen. Anders ausgedrückt: Diese RNA-Medikamente schalten gezielt nur krankmachende Bakterien aus, während die nützlichen Darmbakterien verschont bleiben.
StressRegNet analysierte über 130.000 Wirkstoff-Pathogen-Interaktionen mit Salmonella und Campylobacter. Das Projekt identifizierte nicht-antibiotische Verbindungen mit selektiver antimikrobieller Wirkung und entwickelte KI-gestützte Tools wie DGrowthR und das Deep-Learning-Modell MolE zur Vorhersage antimikrobieller Aktivität ungetesteter Substanzen. Einfach erklärt: KI-Modelle können nach der Analyse von über 130.000 Kombinationen vorhersagen, welche Substanzen gegen resistente Keime wirken könnten.



Wissenschaftliche Exzellenz wird honoriert:
Die Qualität der Forschung zeigt sich in zahlreichen Auszeichnungen: Prof. Dr. Jörg Vogel wird mit dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Prof. Dr. Cynthia Sharma erhielt 2023 den Hauptpreis der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie sowie 2022 den Max-von-Pettenkofer-Preis. PD Dr. Katja Dettmer-Wilde wurde 2022 mit dem Gerhard-Hesse-Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker geehrt. Prof. Dr. Fabian Theis erhielt 2021 den Hamburger Wissenschaftspreis. Prof. Dr. Diana Dudziak wurde mit dem Paul-Langerhans-Preis der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung ausgezeichnet.


Dank und Ausblick:
Die Forschungsteams und die Geschäftsstelle danken dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für die großzügige Förderung. Besonderer Dank gilt Prof. Dr. Horst Domdey für die wissenschaftliche Leitung des Netzwerks und Dem Leiter des Wissenschaftlichen Beirats Herrn Prof. Jörg Hacker sowie seine Stellvertreterin Prof. Dr. Tanja Schneider.

Wir danken allen beteiligten Universitäten: LMU München, TU München, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Universität Regensburg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Universität Augsburg, sowie dem Leibniz-Rechenzentrum, dem Genzentrum München und allen Kooperationspartnern.
Vor allem aber danken wir den über 85 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie allen ehemaligen und zeitweise Mitwirkenden, die mit ihrer Expertise dieses Netzwerk zum Erfolg geführt haben.
AMR Experten aus ganz Deutschland bestätigen es: die Frage ist nicht, ob multiresistente Erreger und Wissenschaftliche Förderung allgemein weiterhin wichtige Themen bleiben, sondern ob wir die notwendigen Schritte rechtzeitig und gemeinsam gehen um in diesen wichtigen Bereichen der Forschung mit dem Rest der Welt mithalten zu können.
Mit bayresq.net hat Bayern bereits einen wichtigen Schritt für Deutschlands sowie auch für Europas Forschungs und Innovationslandschaft getan.